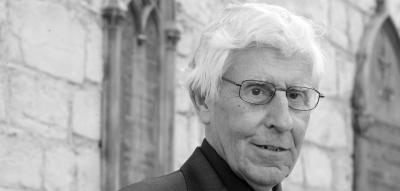Der Verein der Freunde der Nationalgalerie in Berlin hat 2024 ein Werk von Jumana Manna gekauft – als längst bekannt war, dass die Künstlerin die Terrorattentate am 7. Oktober 2023 auf Social Media gefeiert hatte. Bilder flüchtender Teilnehmer des Festivals, bei dem über 250 Menschen ermordet wurden, versah Manna mit dem Kommentar „Es ist kein Spaß, in der Nähe des größten Gefängnisses der Welt zu raven“; eine Aufnahme, die Hamas-Terroristen beim Angriff auf Israel mit Gleitschirmfliegern zeigt, mit „Lang lebe die Kreativität des Widerstands“.
2017 war die Künstlerin mit palästinensischen Wurzeln, die in den USA geboren wurde, in Berlin lebt und einen israelischen Pass besitzt, für den Preis der Nationalgalerie nominiert. Erworben wurde nun Mannas Skulptur „Ghost“ von 2022: eine aus einer Werkserie extrahierte und somit etwas verloren wirkende Plastik aus Keramik, Beton und Kalk, die sich auf Aufbewahrungsbehälter in der Levante beziehen soll und ein bisschen aussieht wie ein von Karies befallener Zahn. Gezeigt wurde sie in Mannas Ausstellung im Museum of Modern Art New York 2022/2023, was den Freundeskreis bei seiner Wahl, die final von der Direktion der Nationalgalerie für Gegenwart Hamburger Bahnhof besiegelt wurde, anscheinend beflügelte.
Auf die Frage, ob Jumana Mannas Äußerungen vor dem Kauf diskutiert wurden, hieß es von verantwortlicher Seite des Museums, die Kaufentscheidung sei vor dem 7. Oktober getroffen worden – ganz so, als hätte man sie dann nicht mehr hinterfragen können. Weiter hieß es, dass man bei den vielen Erwerbungen nicht alle Inhalte prüfen könne. Zudem wolle man als Museum nicht spalten, sondern zusammenführen und allen Stimmen Raum geben.
Man wundert sich: Ein Museum hat keine Zeit, sich mit Künstlern und ihren Kontexten zu beschäftigen, zu denen heute zwangsläufig Einträge in sozialen Medien gehören? Und wie klappt Zusammenführung durch Gewaltverherrlichung? Auch auf die Frage, ob Mannas Posts dem Museum bekannt waren, hieß die Antwort nein – ohne nachzufragen, wie die Inhalte der Posts lauteten.
Das Schweigen des Kunstbetriebs zum 7. Oktober
Manna selbst hatte ihre Kommentare einige Wochen nach dem 7. Oktober im digitalen Kunstmagazin „Hyperallergic“ relativiert, sich im selben Zuge aber auch als Opfer einer „Schmierenkampagne“ bezeichnet. Ferner stellte sie sich als Opfer der „Zensur“ propalästinensischer Stimmen in Deutschland dar. „Als ich meine Geschichten auf Instagram teilte, war noch nicht klar, dass Hunderte vorsätzlich erschossen und entführt worden waren“, schrieb sie in ihrem Beitrag. „Ich bedauerte meine eigenen Kommentare, nachdem die Nachrichten das Ausmaß der Gewalt offenbart hatten. An alle, mit denen ich solidarisch bin, ob Juden, Araber oder andere: Ich billige die Ermordung von Zivilisten weder, noch feiere ich sie, und ich bagatellisiere Schmerz und Trauer nicht.“ Dass sie ihre Posts nicht löschte, als das Ausmaß der terroristischen Gewalttaten längst klar war, unterschlug sie indes.
Es ist erstaunlich: Eines der wichtigsten Museen Deutschlands kauft ein Werk einer Künstlerin, die Gräueltaten der Hamas glorifiziert, was international Wellen schlägt – und es erklärt, davon nicht gewusst zu haben. Noch scheint es sich dafür zu interessieren. Das Schweigen des Kunstbetriebs zu den Hamas-Attacken war ohrenbetäubend, die Verurteilung von Israels Reaktionen umso lauter. Spätestens seit der Documenta 15 wird Israelhass, oft einhergehend mit Menschenverachtung bis hin zu Antisemitismus, inzwischen offen geäußert, geduldet und mitunter gefördert. Wäre Mannas Arbeit auch gekauft worden, hätte die Künstlerin die Bomben auf Gaza beklatscht? Wohl kaum, denn die Empörung der Kunstszene geht oft nur in eine Richtung.
Ob sich das Museum nicht wenigstens zu Jumana Mannas Gewaltverherrlichung äußern oder die Künstlerin um einen Kommentar bitten wolle? Nein, hieß es, man sei natürlich gegen Gewalt, aber dann dürfe man gar keine Nachrichten oder Filme mehr schauen, wir seien ja von Gewalt umgeben. Sosehr man sich eine schlüssige Antwort, eine Verblüffung über die eigene Ignoranz oder eine Distanzierung von Mannas Aussagen gewünscht hätte: Es schlugen einem Schulterzucken und Abwinken entgegen. Der Freundeskreis selbst antwortete auf Fragen zu Mannas Posts nicht, sondern beschrieb lediglich formell den Ablauf des Ankaufs, der „einstimmig“ beschlossen wurde.
Dagegen sagte die Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) einen Vortrag von Jumana Manna Anfang Dezember 2024 ab, nachdem die Hochschulleitung von den Posts erfahren hatte. Auch das NS-Dokumentationszentrum in München handelte verantwortungsbewusst. Vor einigen Jahren wurde dort ein Video von Manna gezeigt – in einer an diesem Ort fragwürdigen Ausstellung über Postkolonialismus, kuratiert von Nicolaus Schafhausen.
Das Zentrum (wo Schafhausen eigentlich eine Stelle antreten sollte, doch es blieb nur bei dieser Schau) distanziert sich auf der Website „ausdrücklich und umfassend von den von Jumana Manna getätigten Aussagen und in den sozialen Medien geteilten Beiträgen zum Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und den darauffolgenden Ereignissen. Wir verurteilen grundsätzlich jede Verherrlichung von Terror, Krieg und Gewalt.“ Die ostentative Gleichgültigkeit in Berlin aber ist nicht nur unbegreiflich, sondern schlichtweg nicht zu rechtfertigen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.