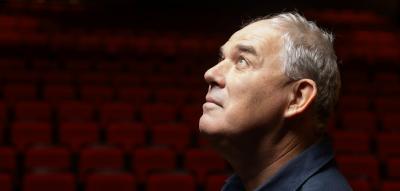Mit dem Wort Rassismus ist mittlerweile so vieles erklärt worden, dass es nun gar nichts mehr erklärt. Wenn noch irgendein Beweis dafür nötig gewesen wäre, dass der Begriff durch den ausufernden Gebrauch im vergangenen Jahrzehnt jede Beschreibungsschärfe verloren hat und nur noch ein Wortwölkchen ist, das man nach Bedarf in die eigene Erregungsblähung hineinpusten kann, dann sind es die Medienreaktionen auf den Sketch von Dieter Hallervorden in der Jubiläumssendung zum 75-jährigen Bestehen der ARD.
In dieser Neuauflage seines aus schwer nachvollziehbaren Gründen als legendär geltenden „Palim Palim“-Sketches von 1977 – damals noch mit dem Vornamen Didi statt Dieter – spielt der 89 Jahre alte Hallervorden kurz gesagt einen Gefängnisinsassen, der sich darüber wundert, dass ihn der ahnungslose Gebrauch der heute tabuisierten Wörter „Negerkuss“ und „Zigeunerschnitzel“ in die Zelle gebracht hat. Er verwendet diese Wörter nicht als realer Dieter Hallervorden, sondern als dramatische Person in einem künstlerischen Bühnentext. Beide Ausdrücke bezeichnen keine Menschen, sondern Speisen. Weder Hallervorden noch seine Figur machen sich dafür stark, weiterhin Menschen als „Neger“ oder „Zigeuner“ zu bezeichnen. Thema des Sketches ist lediglich die Verwirrung eines alten Mannes, der sich in einer Welt nicht mehr zurechtfindet, in der auch „Pizza Hawaii“ oder „Schwarzfahrer“ von Mikro-Fraktionen der identitären Bewegung als „rassistisch“ oder „kolonialistisch“ gebrandmarkt worden sind.
Von den üblichen Erregungssuppenköchen in den sozialen und den alten Medien ist Hallervorden deshalb des Rassismus beschuldigt worden. Dabei entspricht, sein Sketch nicht einmal den schon ziemlich zeitgeistig ausgeweiteten Rassismus-Definitionen der Amadeu-Antonio-Stiftung und der Bundeszentrale für politische Bildung. Auf der Web-Seite der einen wird „Rassismus“ erklärt als „eine Ideologie, die Menschen aufgrund ihres Äußeren, ihres Namens, ihrer (vermeintlichen) Kultur, Herkunft oder Religion abwertet. (…) Wenn Menschen nicht nach ihren individuellen Fähigkeiten und Eigenschaften oder danach, was sie persönlich tun, sondern als Teil einer vermeintlich homogenen Gruppe beurteilt und abgewertet werden, dann ist das Rassismus.“
Bei der anderen heißt es: „Durch Rassismus werden Menschen zum Beispiel wegen ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Haare, ihres Namens oder ihrer Sprache diskriminiert, ausgegrenzt und abgewertet. Rassismus ist die Erfindung, dass es bei Menschen unterschiedliche ,Rassen’ gibt. Und Rassismus ist die Erfindung, dass diesen ,Rassen’ eine Ordnung oder eine Reihenfolge haben.“
Nichts davon propagiert Hallervorden in seinen Sketch. Rassismus wird ihm lediglich vorgeworfen, weil auch der nicht ideologisch motivierte Gebrauch bestimmter Wörter mittlerweile als „diskriminierend“ gilt. Und weil die Bedeutung des Verbs „diskriminieren“ in jüngerer Zeit noch mehr bis zur Bedeutungslosigkeit ausgeweitet worden ist als diejenige des Substantivs „Rassismus“. „Diskriminierend“ ist mittlerweile alles, was irgendwer aufgrund privatester Empfindungen dazu erklärt.
Hinter all diesen aufgeregt verteidigten Tabus steckt auch die Idee man könne Wörter ganz zum Verschwinden bringen, wenn man sie wirklich nirgendwo mehr gebraucht und so ihre Reproduktion stoppt. Das führt dann dazu, dass deutsche Verlage sich für die Verwendung von „Nigger“ in einem historischen Roman entschuldigen – wie bei Colson Whitehead geschehen. Oder noch absurder: dass eine Historikerin wie Hedwig Richter in ihren Büchern historische Texte verfälscht. In einem längeren Zitat aus der Kolonialpropaganda steht bei ihr beispielsweise „N*“ statt des originalen „Neger“. Sollte die Auslöschung des letzteren Wortes langfristig gelingen, werden Menschen in 500 Jahren dann wohl denken, „N*“ sei der übliche Begriff gewesen, mit dem man um 1880 schwarze Menschen bezeichnete – und über dessen Aussprache rätseln.
Diese Problematik verhandelt die Hallervorden-Satire. Vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Humorniveau und mit größter sprach-philosophischer Finesse. Aber die Kunstfreiheit gilt nicht nur für die Gipfelprodukte, und die Meinungsfreiheit nicht nur ab einem bestimmten Niveau feinsinniger Differenzierung.
Matthias Heine ist Redakteur im Feuilleton. In seinem Buch „Kaputte Wörter?“ setzt er sich mit Sinn und Unsinn der Debatten um rund 80 heute umstrittene Begriffe auseinander.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.