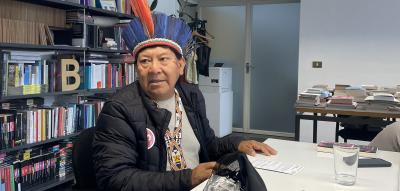Am Ostersonntag stehen die New Yorker entlang der Fifth Avenue zwischen der 49. und der 57. Straße Spalier, um sich die Parade anzuschauen. Die Tradition geht bis ins 19. Jahrhundert zurück, als die High Society nach dem Kirchgang die Fifth Avenue hinabspazierte, um einander ihre schicke Garderobe vorzuführen.
In Richard Yates’ Roman „The Easter Parade“ (1976) ist es ein April im Zweiten Weltkrieg, als die Grimes-Schwestern auf ihre jeweilige Weise an der Parade teilnehmen: Sarah, die Ältere und Hübschere, im Arm ihres Freunds Tony, den sie bald heiraten wird, und Emily, die Jüngere und weniger Hübsche, am Fenster der Wohnung ihrer Mutter, durch die Vorhänge blinzelnd.
„Über Ostern“, schreibt Yates, „liehen Sarahs Arbeitgeber ihr ein teures Kleid aus schwerer Seide, angeblich ein Modell der Kleider, wie sie aristokratische Chinesinnen vor dem Krieg getragen hatten, und einen dicht geflochtenen Strohhut mit breiter Krempe.“ Die Fotografen der „New York Times“ sind begeistert von dem jungen Paar, am nächsten Tag erscheinen die Bilder in der Tiefdruckbeilage: „Die Kamera hatte Sarah und Tony eingefangen, als sie sich im Aprilsonnenschein wie die Verkörperung romantischer Liebe anlächelten, in ihrem Rücken waren Bäume und gerade noch eine Ecke des Plaza Hotels zu erkennen.“
Das war es dann auch langsam mit dem Glück. Der erste Satz des Romans hatte es schon angekündigt: „Keine der Grimes-Schwestern sollte im Leben glücklich werden, und rückblickend schien es stets, dass die Probleme mit der Scheidung ihrer Eltern begonnen hatten.“ Das klingt ein wenig nach Tolstoi oder nach Tschechow, und obwohl Yates natürlich Amerikaner ist – 1926 in Yonkers, New York, geboren und 1992 in Alabama gestorben –, ist man damit auf der richtigen Fährte.
Yates’ Prosa hat nichts von den schwindelerregenden Trapezkünsten eines Nabokov, dem obsessiven Witz eines Roth oder der übergeschnappten Paranoia eines Pynchon, die alle seine Zeitgenossen waren. Sein Stil ist ruhig und sonnenbeschienen wie einer jener Ostertage, mit denen der Roman beginnt und endet. Yates registriert die Enttäuschungen, die sich zu einem Leben summieren – eigentlich sogar zu drei Leben, denn Sarah und die Mutter Pookie spielen auch eine Rolle. Aber der Fokus liegt auf Emily, der zarten, naiven Emily, die alles erspürt und nichts versteht. Sie ist wie ein waidwundes Tier, das mit großen Augen seine ungläubigen letzten Schritte macht durch den garstigen Wald der Menschheit.
Yates’ berühmtestes Buch ist „Revolutionary Road“ (1961), in dem es ebenfalls um das Scheitern von Kleinbürgerträumen geht und das mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet verfilmt wurde. Der Autor rührte auch dort schon jede Menge Autobiografisches unter. So ist es auch in „The Easter Parade“. Der abwesende Vater der Mädchen, ein kleiner Korrektor bei einer reaktionären Zeitung, raucht und trinkt sich früh zu Tode. Yates zeichnet ein prophetisches Selbstporträt. Wem zu Ostern der Sinn nach herzzerreißender Klarsicht auf das Leben steht, der sollte sich diesen zu Unrecht halbvergessenen Autor zu Gemüte führen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.